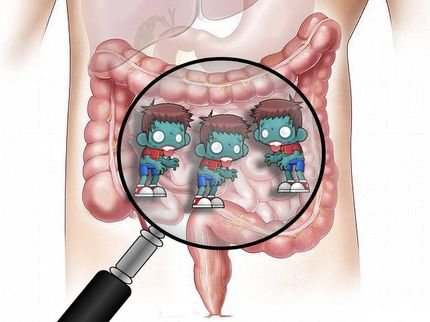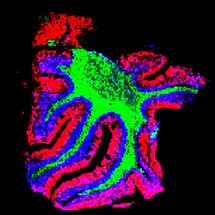Zellulärer DNA-Sensor alarmiert bei Erbgut-Invasion
Viren und Bakterien hinterlassen im Körper oft auffällige Spuren. So kann bei einer Infektion Erreger-DNA freiwerden, die dann die körpereigenen Abwehrtruppen auf den Plan ruft. Dazu verfügt jede Körperzelle im Zellplasma über eine Art DNA-Sensor, der bei fremdem Erbgut Alarm schlägt. Wie dieser Sensor genau aussieht, war bislang unbekannt. Forscher der Universitäten Bonn und Massachusetts liefern nun jedoch auf diese Frage eine Antwort. Ihre Studie ist in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Nature erschienen.
Jeder Krimi-Leser kennt das: Manchmal hat man die Lösung genau vor der Nase, ohne es zu wissen. In diesem Fall war es genauso: Das Molekül, das sich schließlich als DNA-Sensor entpuppte, war nämlich schon länger bekannt. Es fristete bislang aber ein weitgehend unbeachtetes Dasein - vor allem deshalb, weil niemand seine Funktion kannte.
Die Rede ist von einem Protein mit der kryptischen Bezeichnung AIM2. Entdeckt wurde es vor gut 10 Jahren - und zwar paradoxer Weise deshalb, weil es in manchen Zellen fehlt: So verfügen bestimmte Hautkrebszellen über kein AIM2. Daher stammt auch der Name: Absent In Melanoma, also "abwesend in Hautkrebszellen". "Die meisten anderen Körperzellen bilden jedoch AIM2", erklärt Professor Dr. Veit Hornung. "Allerdings wusste niemand, zu welchem Zweck." Bislang zumindest. Denn der Bonner Immunologe konnte jetzt zusammen mit US-Kollegen nachweisen, dass es sich bei AIM2 um den lange gesuchten Erbgut-Sensor handelt.
Die zelleigene DNA schwimmt nicht einfach frei in der Zelle herum, sondern ist im Zellkern verpackt. "Freie DNA im Zytoplasma der Zelle stammt meist von Krankheitserregern, also beispielsweise Bakterien oder Viren", erklärt Hornung. "Alternativ kann bei bestimmten Krankheitsprozessen auch körpereigene DNA freigesetzt werden." Wenn AIM2 auf einen derartigen freien DNA-Faden stößt, dockt es daran an und setzt dann eine komplizierte Signalkette in Gang. An ihrem Ende steht die Freisetzung so genannter Zytokine. Diese alarmieren die körpereigenen Abwehrtruppen. Folge ist eine Entzündungsreaktion, die den Erregern das Leben schwer machen soll. Der DNA-Sensor ist Teil des so genannten angeborenen Immunsystems, das bereits sehr früh im Laufe der Evolution entstanden ist.
Dass DNA starke Entzündungsreaktionen auslöst, nutzte unbewusst übrigens bereits Edward Jenner, der Urvater der Impfung, um das Immunsystem zu Höchstleistungen anzuspornen. "Je mehr wir in diesem Zusammenhang über die DNA-Erkennung wissen, umso besser", betont Hornung. Die Ergebnisse der Nature-Studie lassen aber auch auf ein besseres Verständnis von Autoimmunkrankheiten hoffen. Dazu zählt beispielsweise der Lupus erythematodes. Bei diesem Leiden zerstören die Abwehrzellen das körpereigene Bindegewebe. Hornung: "Es wäre möglich, dass Lupus aufgrund einer fehlgesteuerten Aktivierung von AIM2 durch eigene Erbgut-Moleküle ausgelöst werden kann."
Professor Hornung hat erst vor kurzem den Ruf auf eine Professur im Institut für Klinische Biochemie und Pharmakologie der Universität Bonn erhalten. Zuvor hat er zwei Jahre an der Universität von Massachusetts gearbeitet. Dort fand auch ein großer Teil der Arbeiten zur Rolle von AIM2 statt. Den Direktor des Instituts Professor Dr. Gunther Hartmann kennt Hornung noch aus gemeinsamen Zeiten an der LMU München.
Meistgelesene News
Themen
Organisationen
Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang
Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.