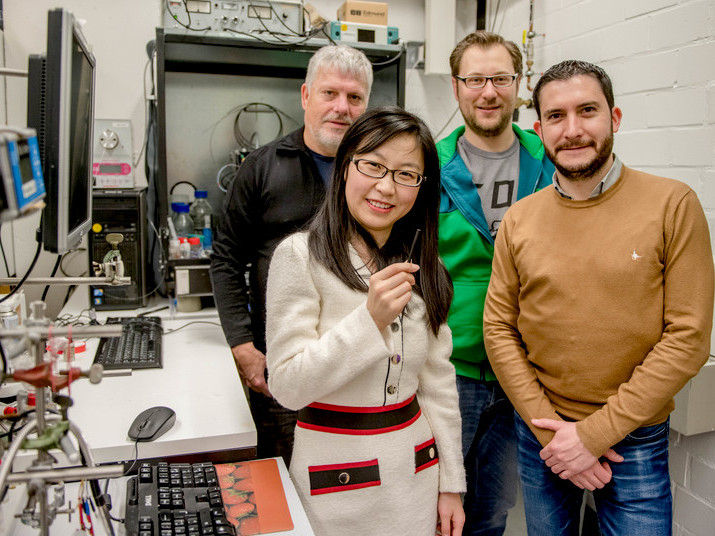Ausblick bis 2019: Neue Medikamente gegen 120 Krankheiten
Bis 2019 sollen rund 120 Krankheiten besser behandelbar oder vermeidbar werden. Es könnte bis dahin u.a. Impfungen gegen sieben Krankheiten geben, vor denen man sich heute noch nicht schützen kann - etwa Ebola, Dengue-Fieber, Noroviren- und MRSA-Infektionen. Das geht aus einer Erhebung des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa) hervor. Der vfa hatte dafür seine Mitgliedsunternehmen nach neuen Medikamenten und neuen Anwendungen für vorhandene Medikamente gefragt, die bis 2019 zugelassen werden könnten, wenn ihre Entwicklung weiter gut verläuft.
"Ein Drittel unserer Projekte führen wir für Krebspatienten durch. Der Bedarf an neuen Behandlungsmöglichkeiten ist hier sehr hoch, aber auch der erreichte Kenntnisstand der Grundlagenforschung. Das ermöglicht es unseren Forschern, darauf aufbauend viele neuartige Medikamente zu entwickeln," erklärte Birgit Fischer, die Hauptgeschäftsführerin des Verbands der forschenden Pharma-Unternehmen (vfa).
Auch auf anderen Gebieten sind Fortschritte absehbar. So dürfte sich das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen nun auch für solche Patienten senken lassen, deren Cholesterinspiegel sich mit bisherigen Medikamenten nicht auf normale Werte bringen ließ. Neue Antibiotika sollen den hartnäckigen Darmkeim Clostridium difficile oder mehrfach resistente gramnegative Bakterien bekämpfen. Ferner könnten erste Medikamente kommen, die den Knorpelabbau bei Arthrose bremsen. Bei Patienten mit schwer kontrollierbarem Asthma sollen künftig weitere Präparate für mehr Anfallfreiheit sorgen.
Bei fast der Hälfte der Medikamente ist vorgesehen, sie auch für Kinder und Jugendliche zu entwickeln. Darunter sind Mittel gegen Hepatitis C, Schmerzen, Schizophrenie und verschiedenen Krebsarten.
42 Medikamente (13 %) dienen zur Behandlung von Patienten mit seltenen Krankheiten. "Dieser Anteil hat sich in den letzten Jahren verstetigt", erläuterte Dr. Siegfried Throm, Geschäftsführer Forschung/Entwicklung/Innovation. "Die Unternehmen nehmen diese Krankheiten also wichtig, lassen dafür die häufigeren aber nicht außer Acht - wie das mancherorts befürchtet wurde." Dieses Engagement könnte in den kommenden Jahren u. a. zu neuen Medikamenten gegen spinale Muskelatrophie, Hirntumore und Bauchspeicheldrüsenkrebs führen.
Einige Arzneimittel werden auch gegen Krankheiten entwickelt, die vor allem Patienten in Entwicklungs- und Schwellenländern treffen. Dazu zählen Malaria, Tuberkulose, Chagas, Schlafkrankheit, Dengue-Fieber und Ebola. Gegen zwei Wurmkrankheiten werden zudem spezielle kleinkindgerechte Tabletten entwickelt. Bei diesen Projekten kooperieren die Unternehmen meist mit nicht-kommerziellen Partnern in Product-Development-Partnerships.
Pharmaforschungsstandort Deutschland
Pharmaforschung ist international: Die Medikamente kommen aus Labors vieler Länder. Der Erhebung nach sind bei rund 12 % der neuen Wirkstoffe deutsche Industrielabors beteiligt. Gerade strukturell außergewöhnliche Wirkstoffe, bei denen z. B. synthetische DNA nicht als Erbsubstanz, sondern als Baumaterial für kompliziert geformte Moleküle verwendet wird, kommen bevorzugt aus Deutschland. Auch bei der Entwicklung monoklonaler Antikörper steht Deutschland in vorderster Reihe.
Sehr umfassend ist der Beitrag deutscher Kliniken und Arztpraxen: Sie wirken an den Studien für 83 % der Arzneimittelprojekte mit, insgesamt an fast 700 industriefinanzierten Studien jährlich. "Damit ist Deutschland nach wie vor die Nummer 2 nach den USA, was die Beteiligung an diesen klinischen Studien betrifft", konstatierte Birgit Fischer. "Und kaum ein Medikament wird zugelassen, das nicht zuvor unter Mitwirkung deutscher Ärzte und Patienten erprobt wurde. Es ist eine Stärke der hiesigen Ärzteschaft und des deutschen Gesundheitswesens, dass sie so umfassend an der Entwicklung neuester Therapien mitwirken und diese damit interessierten Patienten schon vor der Zulassung zugänglich machen. Diese Stärke des Standorts gilt es zu erhalten!" Dass die Beteiligung nicht noch höher ist, liegt Fischer zufolge an den unkalkulierbaren, z.T. extrem langen Genehmigungszeiten für Studien mit begleitender Röntgen-, CT- oder PET-Diagnostik. Die zwängen Studieninitiatoren meist, auf die Mitwirkung deutscher Kliniken zu verzichten. "Verbindliche und EU-konforme Genehmigungsfristen würden daher Chancen für Standort und Patienten durch bis zu 15 Prozent mehr Studien eröffnen.Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Forschung durch unterstützende Rahmenbedingungen gefördert weden kann." Dies sei auch deshalb wichtig, da Forschung und Produktion oft Hand in Hand gingen: "Mit einer Förderung der Forschung wird auch der Produktionsstandort Deutschland gestärkt."