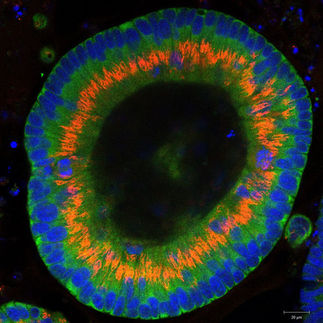„Gendiagnostikgesetz hält der Praxis nicht stand“ – Wissenschaftsakademien fordern Novellierung
Wesentliche Teile des deutschen Gendiagnostikgesetzes entsprechen nicht dem Stand der Technologie, sind in der medizinischen Praxis kaum umsetzbar oder haben negative Auswirkungen auf den Erfolg anerkannter Vorsorgeuntersuchungen, wie das Neugeborenenscreening. Das Gesetz, das seit Februar 2010 in Kraft ist, ist dringend novellierungsbedürftig. Zu diesem Schluss kommt die Akademiengruppe „Prädiktive Genetische Diagnostik als Instrument der Krankheitsprävention“ von Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften, acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (für die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften).
„Wir treten in das Zeitalter der genetischen Medizin ein“, so der Leiter der Akademiengruppe Prof. Peter Propping. Die sachliche Auseinandersetzung mit der Thematik sei für Öffentlichkeit und Politik wichtig. Prädiktive genetische Diagnostik ist das frühzeitige Erkennen von Krankheitsneigungen auf der Basis einer Analyse der menschlichen Gene. Diese Art von Vorsorge wird bedeutsamer, da die Wissenschaft immer mehr genetische Varianten kennt, die mit Krankheitsdispositionen verbunden sind. Das betrifft unter anderem einige Formen erblicher Krebserkrankungen. Das Papier diskutiert sämtliche Aspekte genetischer Untersuchungen an gesunden Menschen zur Vorbeugung von Krankheiten und damit die medizinischen, ethischen, ökonomischen und rechtlichen Dimensionen der Thematik.
Grundsätzlich stellen die Wissenschaftler der Akademiengruppe fest, dass eine prädiktive genetische Diagnostik nur auf Antrag und im Interesse des einzelnen Menschen geschehen darf. „Der Respekt vor der Selbstbestimmung des Patienten ist zentral“, so Propping. Auch eugenische Vorstellungen, die zum Ziel haben, bestimmte Gene aus der Summe aller individuellen Genome einer Bevölkerung zu eliminieren oder gar den menschliche Genpool systematisch „verbessern“ zu wollen, lehnen die Wissenschaftler kategorisch ab.
Die Stellungnahme diskutiert auch Schwächen und Lücken des deutschen Gendiagnostikgesetzes. „Das Gesetz soll den Menschen schützen. Dafür muss es aber angemessene Antworten auf die Fragen der Praxis finden“, fasst Propping den Befund der Akademiengruppe zusammen. Änderungen seien notwendig, um etwa Folgendes auszuschließen:
Beispiel 1: Neugeborenenscreening
Das Gesetz definiert das jahrzehntelang bewährte Neugeborenenscreening als genetische Reihenuntersuchung. Das hat zur Folge, dass die Eltern vor der Blutentnahme aus der Ferse ihres Kindes genetisch beraten werden müssen. Säuglingsschwestern oder Hebammen dürfen jedoch nicht beraten, sondern nur ein Arzt. So mehren sich die Hinweise, dass etwa bei Hausgeburten die Blutabnahme und das Screening unterbleiben, obwohl das nicht dem Wunsch der Eltern entspricht. Somit ist es nicht in allen Fällen möglich, betroffenen Kindern eine Therapie anzubieten, auch wenn diese dringend notwendig wäre. Das Gesetz sollte daher dahingehend geändert werden, dass auch Säuglingsschwestern oder Hebammen die Eltern über das Untersuchungsziel aufklären dürfen.
Beispiel 2: Familienaspekt
Das Gesetz schätzt die Schweigepflicht des Arztes höher ein als seine Fürsorgepflicht gegenüber dem Patienten. Wird etwa bei einer Untersuchung nachgewiesen, dass ein Patient mit einer behandelbaren genetischen Erkrankung, die autosomal dominant vererbt wird, die ursächliche Mutation besitzt, wird ihm auch aufgetragen, seine Verwandten auf das Risiko einer möglichen Erkrankung hinzuweisen. Denn bei früher Diagnose lassen sich viele Erkrankungen effektiv behandeln. Das trifft etwa bei den erblichen Formen von Brustkrebs oder Darmkrebs zu. Ärzte haben aber keine Handhabe, zu prüfen, ob diese Informationen innerhalb der Familie erfolgen oder gar bewusst unterbleiben. Das Gesetz sollte die Fürsorgepflicht des Arztes daher nicht grundsätzlich nachrangig behandeln. Der Arzt sollte im Einzelfall abwägen können, ob er die Familienangehörigen bei klarem medizinischem Nutzen in angemessener Form auf das Risiko einer Erkrankung hinweisen soll.
Beispiel 3: Datenspeicherung
Das Gesetz schreibt vor, dass der Arzt die Ergebnisse aus genetischen Untersuchungen zehn Jahre lang aufbewahren muss. Nach dieser Frist sind die Daten zu vernichten. Etwas anderes gilt nur, wenn der Patient eine frühere Vernichtung oder aber eine längere Speicherung verlangt. Zusätzlich hat eine Löschung der Daten auch dann zu unterbleiben, wenn schutzwürdige Interessen des Patienten verletzt werden würden. Diese Regelungen sind im medizinischen Alltag nicht durchführbar und generell nicht sachgerecht. Vor Ablauf der Frist kann nicht immer beurteilt werden, welche Bedeutung der - im Gegensatz zu anderen Untersuchungen - unabänderliche genetische Befund zu einem späteren Zeitpunkt haben kann. Auch kann ein Arzt im medizinischen Alltag unmöglich jeden Einzelfall vor Ablauf der Frist noch einmal neu bewerten und individuell über Vernichtung der Daten oder deren Speicherung entscheiden. Die Ergebnisse sollten daher wieder ohne konkrete Frist aufbewahrt werden dürfen.
Die Gruppe aus 17 Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen - darunter Humangenetiker, Medizinethiker, Juristen und Gesundheitsökonomen - arbeitete 18 Monate lang unter der Leitung des Leopoldina-Präsidiumsmitglieds Prof. Peter Propping (Humangenetiker, Bonn) intensiv an der Stellungnahme, die nun vorliegt. Zur Redaktionsgruppe zählten neben Propping: Prof. Claus Bartram (Humangenetiker, Heidelberg), Prof. Jörg Schmidtke (Humangenetiker, Hannover), Prof. Jochen Taupitz (Medizinrechtler, Mannheim) und Prof. Urban Wiesing, (Medizinethiker, Tübingen).