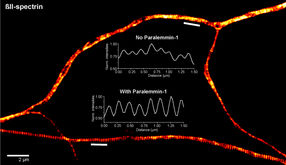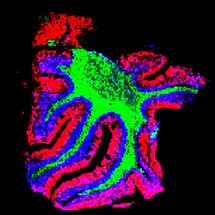Was kostet die Entwicklung eines Arzneimittels wirklich?
Direkte Investitionen, aber auch die hohen Risiken für Misserfolge sowie die lange Zeitspanne bis zur Markteinführung bestimmen zusammen die Entwicklungskosten eines Arzneimittels. Doch was kostet es tatsächlich, ein neues Medikament zu entwickeln? Veröffentlichte Schätzungen dazu kommen zu stark abweichenden Ergebnissen. Welche Ursachen diese Heterogenität haben könnte, ermittelten Wissenschaftler aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ). Ihre jetzt vorgestellte Studie basiert auf einer systematischen Analyse der wissenschaftlichen Literatur.

Symbolbild
pixabay.com
Die Entwicklung neuer Medikamente ist ein riskanter, langwieriger und teurer Prozess. Nach wie vor ist umstritten, wie viel Investitionen tatsächlich erforderlich sind, um einen Wirkstoff mit tatsächlich neuartiger molekularer Struktur auf den Markt zu bringen. Die Kontroverse wird durch Vorschläge angeheizt, den steigenden Preisen für neue Medikamente dadurch zu begegnen, dass Höchstpreise aus den tatsächlich entstandenen Entwicklungskosten abgeleitet werden.
Angesichts der großen Heterogenität der veröffentlichten Schätzungen, die von 161 Mio. US $ (137 Mio. Euro, alle Kosten in Preisen von 2019) bis zu 4,54 Mrd. US $ (3,86 Mrd. Euro) reichen, hat ein Team von Gesundheitsökonomen und Krebsforschern vom DKFZ und vom Deutschen Konsortium für translationale Krebsforschung (DKTK) unter der Leitung von Michael Schlander und Karla Hernandez-Villafuerte eine umfassende Analyse der wissenschaftlichen Literatur zu diesem Thema vorgenommen. Ihre nun veröffentlichte Studie beleuchtet wesentliche Gründe für die große Heterogenität der Schätzungen.
„Gerade in Bezug auf neue Krebsmedikamente wird die Debatte über steigende Entwicklungskosten bereits seit vielen Jahren intensiv geführt. Um zu belastbaren Kostenschätzungen zu kommen, brauchen wir daher robuste Analysen, die wirklich alle relevanten Parameter zuverlässig berücksichtigen und gewichten", sagt Michael Baumann, der Vorstandsvorsitzende des DKFZ und Koautor der aktuellen Publikation.
Die Analyse bestätigt nicht nur den langfristigen Trend stetig steigender Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) pro neu zugelassenem neuen Wirkstoff. Sie zeigt auch Unterschiede nach Therapiegebieten auf, wobei die jüngsten Schätzungen für Krebsmedikamente mit einigem Abstand am höchsten ausfielen (von 944 Mio. $ bis 4,54 Mrd. $ bzw. von 802 Mio. Euro bis 3,86 Mrd. Euro). Eine Teilerklärung für die große Spanne könnte, so Schlander, darin liegen, dass der niedrigere Wert einer Studie entstammt, die nur Projekte von erfolgreichen kleinen Firmen einbezog, also das Entwicklungsrisiko nicht adäquat berücksichtigte.
Jorge Mestre-Ferrandiz, Ko-Autor der Studie von der Universidad Carlos III in Madrid, betont denn auch, dass neben den Kosten für die Durchführung von F&E-Projekten auch das hohe Risiko von Misserfolgen und die langen Entwicklungszeiten bei der Gesamtkostenschätzung berücksichtigt werden müssen. Die Einbeziehung dieser beiden Faktoren führt notwendigerweise zu deutlich höheren, aus Investorensicht aber realistischeren Schätzungen.
Die Studie des DKFZ-Teams ergab auch Hinweise auf weitere Ursachen für die Variation der F&E-Ausgaben pro neuem Wirkstoff. So fanden die Ökonomen Publikationen, die auf höhere Erfolgsquoten bei der Entwicklung großer Moleküle (Biologika einschließlich monoklonaler Antikörper) im Vergleich zu kleinen Molekülen (herkömmliche chemische Verbindungen) hindeuten. Ebenso haben einlizenzierte Wirkstoffe wahrscheinlich eine höhere Erfolgsquote als Moleküle, die aus der eigenen Forschung eines Unternehmens stammen. Schlüssige Beweise für die verbreitete Annahme, dass kleine Firmen erfolgreicher sind als große biopharmazeutische Unternehmen, fanden die Wissenschaftler jedoch nicht.
Einige Studien deuten darauf hin, dass die F&E-Kosten für die Entwicklung eines Medikaments gegen seltene Erkrankungen („Orphan Diseases") im Durchschnitt nur etwa halb so hoch sind wie die Entwicklungskosten für Präparate gegen häufige Krankheiten. Schlander weist darauf hin, dass die Kosten pro Patient dennoch sehr viel höher sein können, insbesondere bei Medikamenten für extrem seltene Krankheiten: „Bei Orphan Diseases sind einerseits klinische Studien oft komplizierter und aufwändiger: Die zugrundeliegende Pathologie ist vielfach weniger verstanden, dadurch ist es schwieriger, Parameter zu bestimmen, an denen sich Krankheitsschwere und des Krankheitsverlaufs zuverlässig messen lassen."
Zu diesen Erkenntnissen gelangte das DKFZ-Team durch eine systematische Analyse der bis März 2020 veröffentlichten wissenschaftlichen Literatur zum Thema pharmazeutische F&E-Ausgaben. Sie identifizierten 22 Studien mit insgesamt 45 Schätzungen der gesamten F&E-Kosten pro neu auf den Markt kommenden Wirkstoff. Die für die Analyse ausgewählten Studien mussten eine klare Beschreibung der Methoden bieten, die zur Erhebung der Inputdaten und zur Berechnung der jeweiligen F&E-Kostenschätzungen verwendet wurden. Darüber hinaus bewertete das Studienteam den Grad des Vertrauens in die F&E-Kostenschätzungen anhand eines transparenten Bewertungssystems, das drei Bereiche abdeckt: 1) wie die Erfolgsquoten und Entwicklungszeiten, die für die Kostenschätzung verwendet wurden, ermittelt wurden; 2) ob die Studie potenzielle Quellen für Schwankungen der F&E-Kosten berücksichtigt hat; und 3) welche Kostenkomponenten für die Analyse verwendet wurden.
Die drei Parameter Barausgaben, Entwicklungsrisiko und Zeit bis zur Markteinführung können je nach Projekt variieren. Der Blick auf die Durchschnittskosten könne daher wichtige Unterschiede zwischen den Produkten verschleiern, warnen die Autoren. Diese Besorgnis wird durch ihre Beobachtung verstärkt, dass in der veröffentlichten Literatur ein Kompromiss zwischen der Transparenz der verwendeten detaillierten Daten und der Spezifität der durchgeführten Analysen besteht. Bei der Bewertung der Zuverlässigkeit der Studien konnte keine der veröffentlichten Analysen in beiden Dimensionen gleichzeitig überzeugen. Das DKFZ-Team schlug ein Punktesystem für die Verlässlichkeit vor, das als Orientierungshilfe für die künftige Forschung dienen sollte.
Die DKFZ-Ökonomen betonen, dass ihre Forschung nicht dazu gedacht war, die Idee einer kostenbasierten Preisgestaltung für neue Arzneimittel zu unterstützen, unter anderem auch aus grundsätzlichen Erwägung, dass eine Preispolitik auf Kostenbasis den Herstellern die Anreize nehmen könne, Forschung und Entwicklung zu beschleunigen und effizient zu betreiben. Auch aus ökonomischer Sicht sprächen gewichtige Argumente für eine am Wert eines Medikaments orientierte Preisfindung gegenüber einer reinen Kostenorientierung.
Michael Schlander sagt „Für die Erstattung und die Preisgestaltung sollte der Mehrwert eines Produkts ausschlaggebend sein, nicht die Ressourcen, die für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb aufgewendet werden. Die Kosten können – wenn überhaupt – nur in Ausnahmefällen eine Rolle spielen, etwa bei Arzneimitteln für extrem seltene Krankheiten. In diesen Fällen sollte die Frage jedoch richtiger lauten, wie der volle gesellschaftliche Wert erfasst werden kann, anstatt die Kosten als Grundlage für die Preispolitik zu akzeptieren."