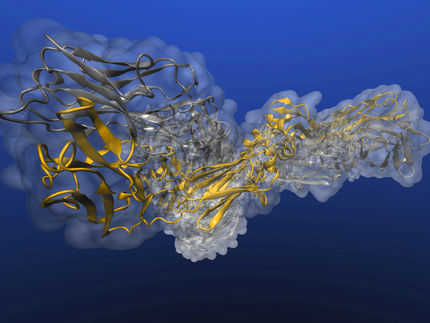Der Mitmensch als Krankheitsträger
Coronavirus weckt viele Ängste
(dpa) Wochenlang war das Coronavirus nur ein Thema in den Nachrichten. Es grassierte weit entfernt in einem anderen Teil der Welt. Es betraf einen nicht. In den letzten Tagen hat sich das geändert.

Symbolbild
geralt, pixabay.com, CC0
Jetzt weicht mancher vielleicht unwillkürlich einen Schritt zurück, wenn an der Bushaltestelle jemand hustet. Jede normale Grippewelle treffe mehr Menschen, hat es lange geheißen. Damit konnte man sich beruhigen. Aber jetzt ist zu hören, dass es bei Atemmasken Lieferengpässe gibt. Man will Desinfektionsgel kaufen und erfährt, dass es erst in drei Tagen wieder reinkommt. Der zwölfjährige Sohn kommt nach Hause und sagt: «Bei uns hat einer erzählt, dass wir bald wohl nicht mehr zur Schule müssen.» Supermärkte melden Hamsterkäufe.
Gottesdienstbesucher sollen sich nicht mehr die Hand zum Friedensgruß geben. Messen und Turniere werden abgesagt, es steht die Frage im Raum, ob die Olympischen Spiele in Tokio stattfinden können. In China stehen mehr als 50 Millionen Menschen unter Quarantäne, so viele wie noch nie zuvor in der Geschichte.
Christian Drosten, Virologe und Institutsdirektor von der Berliner Charité, wehrt sich bei «Maybrit Illner» gegen «aufgeregte Debatten», hebt aber auch hervor: «Es geht nicht um eine normale saisonale Grippe, dieser Vergleich hinkt, sondern es geht um ein pandemisches Geschehen.» Das habe es zum letzten Mal 1957 und 1968 gegeben. «Praktisch niemand kann sich mehr ernsthaft daran erinnern.» Auf Nachfrage stellt er klar: «Es wird schlimm werden.» Das lässt einen als Zuschauer schlucken. «Schlimm.» Und das von einem nüchternen Wissenschaftler.
Im Fall des Coronavirus kommen mehrere Faktoren zusammen, die das Gefühl der Bedrohung verstärken. Zunächst einmal würden Risiken, die nicht beobachtbar seien - etwa radioaktive Strahlen oder eben Viren - generell als bedrohlicher wahrgenommen, sagt Ralph Hertwig, Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin und spezialisiert auf die Psychologie des Risikos. «Zudem lösen neuere Risiken eine stärkere Reaktion aus als solche, an die man sich schon gewöhnt hat.» Ein weiterer Faktor ist die Unsicherheit: Es ist noch unklar, wie viele Menschen letztendlich von dem Virus betroffen sein werden. «Dazu kommt, dass man das Gefühl hat, das Risiko nicht richtig beherrschen zu können: Es gibt vorerst keinen Impfstoff.»
All dies hat das Potenzial, Angst auszulösen. Wer Angst hat, tendiert dazu, sich nicht mehr rational zu verhalten. Er denkt in erster Linie an sich selbst und an die engste Familie. Im Extremfall rennt die Mutter unangemeldet mit ihrem verschnupften Kind in die Arztpraxis, weil sie befürchtet, dass es das neue Coronavirus haben könnte - nicht bedenkend, dass sie in diesem Fall viele andere mit ihrem Verhalten gefährden würde. Der Mitmensch wird in erster Linie als potenzieller Krankheitsträger wahrgenommen - und nicht als jemand, den man theoretisch auch selber anstecken könnte.
Doch nicht nur der Umgang von Menschen untereinander kann sich verändern. Epidemien könnten die Beziehungen zwischen Staaten verschlechtern, sagt Maike Voss, die bei der Stiftung Wissenschaft und Politik für das Gebiet «Globale Gesundheit» zuständig ist. «Die Mitgliedsstaaten der Weltgesundheitsorganisation haben sich darauf geeinigt, wie sie in einem solchen Fall miteinander umgehen müssen, und das ist rechtlich bindend», sagt sie. «Man kann es vergleichen mit einem Meldewesen: Wenn ein Land einen Ausbruch hat, meldet es das an die WHO, so dass sich die anderen Länder vorbereiten können. Dafür wird es dann aber auch nicht von den anderen bestraft, etwa durch Abschottung.»
Dagegen sei allerdings schon verstoßen worden. «Russland hat die Grenzen nach China komplett geschlossen, und das ist nach internationalem Recht eigentlich nicht erlaubt.» Auch die USA hätten Handels- und Reisebeschränkungen eingeführt. «Das wird in den Köpfen bleiben, auch wenn die Pandemie vorbei ist», glaubt Voss. Es gebe aber auch ein positives Gegenbeispiel: «In der EU sehen wir derzeit einen wirklichen Schulterschluss. Da gibt es ein ganz starkes Narrativ, das die Mitgliedsstaaten vereint: ein Erreger, der alle bedroht und den man gemeinsam eindämmen will.»
Wie haben Menschen früher auf Epidemien reagiert? Die schlimmste Seuche des 20. Jahrhunderts war die Spanische Grippe. Dabei gehe man von 25 bis 40 Millionen Toten aus, sagt der Seuchenhistoriker Manfred Vasold. «In Deutschland allein hatten wir 250.000 bis 300.000 Grippetote.» Es war also unvergleichlich viel schlimmer als heute.
Brach damals Panik aus? Überhaupt nicht. Viele Tagebuchschreiber erwähnten die Grippe kein einziges Mal. Gaststätten und Kinos blieben offen. In den Zeitungen las man kaum etwas darüber - denn man schrieb das Jahr 1918, es war die Endphase des Ersten Weltkriegs. Die Regierungen verboten der Presse, über die Grippe zu informieren, mit der Begründung, dass das die Moral der Bevölkerung schwächen würde. Das einzige Land, in dem ausführlich berichtet wurde, war das neutrale Spanien. Dadurch kam im Ausland der Eindruck auf, dieses Land wäre viel stärker betroffen. Daher der Name: Spanische Grippe.
Die damaligen Menschen hätten Epidemien mit Gleichmut hingenommen, sagt Vasold. Das Leben war generell viel unsicherer als heute. «Wenn jemand von einer Reise zurückkam, hat er sich erstmal erkundigt: Ist jemand aus dem Haus gestorben? Wer ist aus der Nachbarschaft gestorben?» Die heutige Aufregung um das Coronavirus würde ein Mensch aus dem Jahr 1918 nicht verstehen.
Risikowahrnehmungs-Forscher Hertwig vom Max-Planck-Institut wirbt dafür, das Risiko durch das Coronavirus nicht zu übertreiben. Er hat auch einen Tipp dafür, wie man einen kühlen Kopf bewahren kann. Bezeichnend findet er Folgendes: Vor einigen Tagen wurde gemeldet, dass im vergangenen Jahr 3.059 Menschen in Deutschland durch Verkehrsunfälle ums Leben gekommen sind. Diese Nachricht war aber an die positive Botschaft gekoppelt, dass dies so wenige seien wie noch nie seit Beginn der Statistik. «Hier wird eine Rahmung vorgenommen», erläutert Hertwig. «Es geht runter, Leute, entspannt euch!» Und trotzdem sind mehr als 3000 Menschen umgekommen.» Hertwig findet: Es kann helfen und dem Gefühl der Panik entgegenwirken, ein Risiko auf diese Weise wieder ins Verhältnis zu setzen.