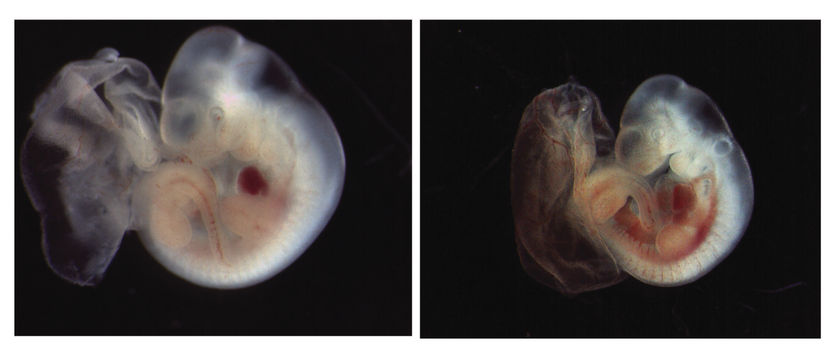Wenn Einsamkeit krank macht
Zusammenhang zwischen Alleinleben und psychischen Krankheiten statistisch untersucht
(dpa) Immer mehr Menschen leben allein - auch in Deutschland. Die steigende Zahl der Einpersonenhaushalte könnte mit mehr psychischen Erkrankungen einhergehen. Diesen Zusammenhang legt zumindest eine Studie der Universität Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines nahe.

Viele Menschen lieben die Freiheit, allein in einer Wohnung zu leben. Andere haben einzig die Lebensumstände dazu gebracht. Nun haben Forscher den Zusammenhang zwischen dem Alleinleben und psychischen Krankheiten statistisch untersucht (Symbolbild).
StockSnap, pixabay.com, CC0
Wie die Forscher im Fachblatt «PLOS ONE» berichten, haben Alleinlebende 1,5- bis 2,5-mal eher eine der häufigsten psychischen Erkrankungen als andere Menschen. Dazu gehören etwa Depressionen sowie Angst- und Zwangsstörungen. Dabei sind alle Altersgruppen und Geschlechter betroffen, wie die Wissenschaftler betonen. Die Studie zeige jedoch nicht, ob das Alleinleben Ursache dieser Erkrankungen ist. Auch die zeitliche Reihenfolge wurde nicht untersucht. Einen statistischen Zusammenhang zwischen dem Alleinleben und Erkrankungen gab es jedoch vor allem bei den Menschen, die sich einsam fühlten.
Eine steigende Lebenserwartung sowie sinkende Heirats- und Geburtenraten sind nur drei der Gründe, die dafür verantwortlich gemacht werden, dass mehr und mehr Menschen allein leben. Einige wählen diese Lebensform auch ausdrücklich.
In Deutschland waren 2016 nach Daten des Statistischen Bundesamtes 41 Prozent aller Haushalte sogenannte Einpersonenhaushalte, ein Anteil, der deutlich über dem EU-Schnitt von 33 Prozent liegt. Die gesundheitlichen Folgen des Trends wurden schon in zahlreiche Studien untersucht. So ergab etwa eine finnische Untersuchung 2012, dass die Wahrscheinlichkeit innerhalb von acht Jahren eine Depression zu bekommen, bei Alleinlebenden um nahezu 80 Prozent erhöht sei.
Das Team um den Mediziner Louis Jacob von der Universität von Versailles nutzte nun die Daten von 20.500 Menschen aus England im Alter von 16 bis 64 Jahren, die 1993, 2000 und 2007 an der «National Psychiatric Morbidity»-Erhebung teilgenommen hatten. Dabei wurde die psychische Gesundheit der Teilnehmer mithilfe von Interviews und Fragebögen ermittelt. Zusätzlich zu den so gesammelten Daten nutzten die Forscher Informationen zu Größe und Gewicht, Alkoholabhängigkeit, Drogenkonsum, sozialem Netz sowie dem Gefühl von Einsamkeit.
In den drei Jahren stieg der Anteil der Einpersonenhaushalte in der Erhebung von 8,8 auf 9,8 und schließlich 10,7 Prozent. Gleichzeitig wuchs die Rate an häufigen psychischen Erkrankungen von 14,1 auf 16,3 und 16,4 Prozent. In allen drei Umfragen war ein statistischer Zusammenhang zwischen dem Alleinleben und der Verbreitung psychischer Erkrankungen feststellbar, so die Mediziner, und das unabhängig von Geschlecht oder Alter der Teilnehmer. Der größte Faktor war dabei Einsamkeit: Fühlte sich jemand einsam, war auch das Risiko einer psychischen Erkrankung besonders hoch.
Jene Feststellung ist auch für Arno Deister, Chefarzt des Zentrums für Psychosoziale Medizin des Klinikums Itzehoe zentral. In seiner unabhängigen Einordnung der Studie betont er, dass es einen Unterschied zwischen Alleinleben und Einsamkeit gebe: «Wenn das Alleinsein gewollt ist, kann es für Menschen durchaus positiv sein.» Einsamkeit bezeichne hingegen den ungewollten Verlust von Beziehungen.
Deister wertet die Studie der Universität von Versailles als sorgfältig aufgebaut und wichtig. Der Psychiater warnt jedoch davor, vorschnell Zusammenhänge herzustellen: «In Großstädten gibt es zum Beispiel mehr Menschen mit psychischen Erkrankungen, was oft mit der Anonymität dort erklärt wird», sagt er. «Häufig suchen psychisch kranke Menschen aber bewusst die Anonymität, zudem ist die Versorgungslage in Großstädten besser.» Zudem: Wenn Alleinsein dazu führe, dass Beziehungen fehlten, dann könne das bestimmte Erkrankungen zwar einerseits begünstigen. «Andererseits ist es etwa ein Symptom von Depressionen, dass sich Menschen zurückziehen.»
Nichtsdestotrotz sei hinreichend erforscht, dass sich Einsamkeit negativ auf die psychische Gesundheit auswirke, kommentiert Psychologie-Professor Jürgen Margraf von der Universität Bochum: «Stabile und vertrauensvolle soziale Beziehungen sind der beste Schutz für die psychische und auch körperliche Gesundheit.»
Wie die Autoren der Studie sieht Margraf gesellschaftliche Veränderungen, die das Alleinleben und somit auch das Potenzial für Einsamkeit begünstigten. Eine Einschätzung, die Deister teilt: «Wir beobachten eine Entsolidarisierung in der Gesellschaft.» Gleichzeitig habe sich das Kommunikationsverhalten, etwa durch soziale Medien, grundlegend verändert: «Die Kommunikation ist ja nicht weniger geworden, sondern wahrscheinlich sogar mehr, aber sie ist eben ganz anders.» Zudem sei Einsamkeit immer noch schambesetzt. Viele einsame Menschen suchten sich daher keine Hilfe: «Entsprechend kommt viel aus der Einsamkeit bei uns in der Therapie nie an.»
Er plädiert dafür, das Thema gesellschaftlich zu setzen und Menschen dafür zu sensibilisieren, ein Auge auf ihre Mitmenschen zu haben. Eben jene Sensibilisierung wurde in Großbritannien medienwirksam angestoßen, in dem das Land 2018 eine Ministerin für Einsamkeit ernannte. Ob es dies auch in Deutschland geben sollte, ist für Deister nicht so wichtig: «Vielmehr sollte einsamen Menschen gezeigt werden, dass ihre Einsamkeit nicht nur ihr Privatproblem ist.»
Hier hat Margraf konkrete Handlungsvorschläge: «Man muss dafür sorgen, dass die Menschen sich begegnen, miteinander ins Gespräch kommen und sich austauschen.» Dabei sei jeder Einzelne gefragt: «Wenn wir unsere Einkäufe nun auch noch ins Internet verlagern, haben wir ein massives Problem.» An seiner Fakultät hat Margraf Begegnungsräume für Mitarbeiter eingerichtet und damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Entsprechende Konzepte ließen sich auch auf die Stadt- und Raumplanung übertragen. Ein weiterer Ansatz: Prosoziales Verhalten sollte vor allem in Schulen gefördert werden, sagt Margraf. «Mobbing in Schulen ist ein starker Faktor für psychische Störungen im Erwachsenenalter.» In Deutschland seien Lehrer indes immer noch oft auf der Seite der Stärkeren. Zudem sollte Gesundheitserziehung Teil des Unterrichts werden und dabei auch psychische Probleme thematisieren, was letztendlich auch der Stigmatisierung entgegenwirken würde.