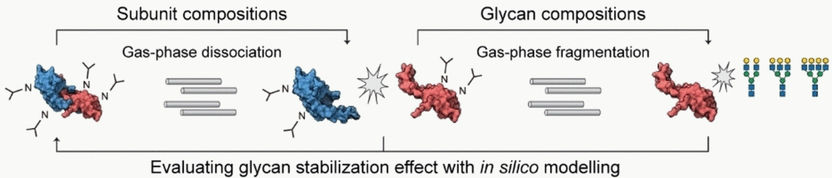Mikropartikel künstlich herstellen
FH-Student baut Mikrodosierpumpe
Aus einem groben Granulat kleinste Mikropartikel herzustellen – das klingt erst einmal unproblematisch. Schließlich ließe sich dieses Ziel durch Zertrümmern leicht erreichen. Ganz so einfach ist es aber nicht, denn die Mikropartikel sollen eine spezifische Größe haben, und die ist mechanisch nicht herstellbar. Deshalb produziert sie Student Marius Wahrenburg auf dem Steinfurter Campus der FH Münster künstlich. Dabei hilft ihm eine Mikrodosierpumpe, die er eigens dafür gebaut hat.

Marius Wahrenburg baut im EUREGIO Biotech Center einen Versuch auf, bei dem die Mikrodosierpumpe Polymere dem Stabilisator hinzufügt. Somit werden Mikropartikel gebildet.
FH Münster/Pressestelle
Mikropartikel entstehen, wenn man einen in wässriger Lösung gebrachten Stabilisator mit einem Polymer in einem anderen Lösungsmittel zusammenbringt. Der FH-Student verwendet dafür Polylactid-co-Glycolid (PLGA), eine Substanz aus der Arzneimittelherstellung. „Das gebe ich tröpfchenweise zum Stabilisator, und dann bilden sich Mikropartikel.“ Je langsamer es tropft, desto größer werden die Partikel – und genau das war das Ziel. Doch mit herkömmlichen Pumpen kam er nicht weiter. „Die tropfen leider viel zu schnell“, sagt Wahrenburg. Nur etwa alle zehn Sekunden sollte ein Tropfen fallen, die beiden getesteten Pumpen verloren jedoch einen Tropfen pro Sekunde. Also überlegte der 28-Jährige, welche Alternativen es gibt. „Ich habe im Studium Biomedizinische Technik das Modul Medizingerätetechnik belegt, und das Wissen daraus war eine gute Basis“, erklärt er. Denn da ging es auch um Infusionspumpen auf der Intensivstation, die den Patienten in konstanter Geschwindigkeit versorgen. „Prinzipiell funktioniert das also, doch diese Geräte sind ziemlich teuer. Und deshalb habe ich selbst eine Pumpe gebaut.“
Zunächst recherchierte er im Internet Vorlagen für das Grundgerüst, um dieses im 3-D-Druck herzustellen. Mehrere Aspekte waren dabei wichtig. „Es sollte möglich sein, Spritzen in verschiedenen Größen zu verwenden, mit denen die PLGA-Lösung aufgenommen werden kann. Das spielt dann eine Rolle, wenn mal andere Mikropartikel produziert werden sollen.“ Außerdem musste die Pumpe einfach in der Handhabung, relativ klein im Aufbau und sterilisierbar sein. Wahrenburg baute einen kleinen Motor an das Grundgerüst, der die Pumpe antreibt. Außerdem widmete er sich der Programmierung des Mikrocontrollersystems, das den Motor steuert. „Das war die meiste Arbeit. Ich hatte zwar im Studium zwei Semester Informatik, musste mich aber trotzdem ganz schön reinarbeiten.“
Als das geschafft war, machte er erste Tests. „Ich habe meine Pumpe über eine Waage gehängt, und alle zehn Sekunden fiel ein Tropfen. Drei Tage lang ging das so, und ich haben die Tropfen zwischendurch immer wieder gewogen. So habe ich herausgefunden, ob die Gewichtszunahme konstant ist.“ Aber das war sie leider gar nicht. „Der Aufbau meiner Pumpe war einfach noch nicht optimal, da musste ich nachbessern.“ Also wagte er einen zweiten Versuch mit einem größeren Grundgerüst, einer größeren Spritze und einem digitalen Display, über das die Tropfgeschwindigkeit ablesbar ist. Erneute Tests zeigten: Das funktioniert tatsächlich. „Die Förderrate ist absolut präzise, sodass deutlich einheitlichere Partikel entstehen“, so Wahrenburg.
Ein Semester lang hat er an seinem Forschungsprojekt im EUREGIO Biotech Center von Prof. Dr. Karin Mittmann gearbeitet. Das Ergebnis fließt in das Projekt „InMediValue“, das Mittmann initiiert hat und nun federführend betreut. Dabei entwickeln grenzüberschreitend Ärzte, Naturwissenschaftler, Ingenieure, technische Assistenten und IT-Spezialisten gemeinsam neuartige Techniken rund um die medizinische Bildgebung. Dazu zählen zum Beispiel Verbesserungen bei Röntgen-Aufnahmen und deren Auswertung im Krankenhaus. Die Mikropartikel spielen im Bereich der endoskopischen Bildgebung eine wichtige Rolle. „Wenn diese Partikel in anschließenden Untersuchungen gute Ergebnisse liefern, könnten sie eine Komponente eines Markers werden. Das Ziel ist es Tumore so zu markieren, dass diese auch in der Schlüsselloch-Chirurgie optisch einfach erkennbar sind und dadurch sehr viel zielgerichteter bekämpft werden können“, so Mittmann.
Im diesem Bereich zu promovieren, das kann sich Wahrenburg gut vorstellen und zwar am liebsten an der FH Münster, an der er seit dem Bachelorstudium eingeschrieben ist – zunächst für Physikalische Technik, jetzt im Master Biomedizinische Technik. Und parallel studiert er dort auch Chemieingenieurwesen. „Mit Chemie habe ich an der Uni angefangen, mich nach ein paar Semestern aber doch lieber für Physikalische Technik an der FH Münster entschieden. Die Credits aus dem Studium an der Uni wollte ich nicht verlieren – und habe deshalb auch noch mit Chemieingenieurwesen begonnen.“