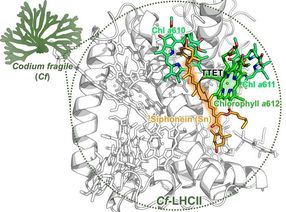Wie Pflanzen ihre Samen bilden
Anzeigen
Ob Früchte oder Körner – der Grossteil unserer Nahrung resultiert aus der Fortpflanzung bei Pflanzen. Wie sie Befruchtung und Samenbildung steuern, haben UZH-Forschende nun entschlüsselt. Das Wissen um diese Signalwege lässt sich nutzen, um neben der Samenbildung auch das Pflanzenwachstum oder die Schädlingsabwehr zu beeinflussen.

Pollenschläuche mit aufgenommenen, Fluoreszenz-markierten Signalstoffen (RALF-Peptide).
UZH
Samen decken – entweder als Nahrung oder indirekt als Futtermittel – ungefähr 80 bis 85 Prozent des menschlichen Kalorienbedarfs. Sie sind das Ergebnis der pflanzlichen Fortpflanzung. In der Blüte interagieren die männlichen und weiblichen Gewebe auf vielfältige Weise miteinander. Lagert sich Pollen auf der Blütennarbe ab, keimt er aus und bildet einen Pollenschlauch. Dieser wächst rasch in Richtung des Fruchtknotens. Sobald er eine weibliche Samenanlage findet, platzt er und setzt zwei Spermien frei. Diese befruchten die Samenanlage und leiten die Samenbildung ein.
Pollenschlauch kommuniziert mit weiblichem Pflanzengewebe
Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Ueli Grossniklaus, Professor am Institut für Pflanzen- und Mikrobiologie der Universität Zürich, zeigt nun, wie der Pollenschlauch mit den weiblichen Pflanzengeweben kommuniziert und darauf reagiert. Dazu sondert der Pollenschlauch Signalstoffe (RALF-Peptide) aus, mit denen er seine zelluläre Umgebung erkundet und sein Wachstum steuert. Zwei Rezeptoren auf der Zelloberfläche erlauben es dem Pollenschlauch, seine ausgesandten Signalstoffe wahrzunehmen und die Signale ins Zellinnere weiterzuleiten.
Zelleigene Signalstoffe steuern das Wachstum
In Zusammenarbeit mit den Gruppen von Christoph Ringli von der UZH und Jorge Muschietti von der Universität von Buenos Aires konnte Grossniklaus Team zeigen, dass weitere Eiweisse aktiv sein müssen, damit der Pollenschlauch die Signalstoffe erkennen kann: die LRX-Proteine. Diese wurden bereits vor 15 Jahren von der Gruppe von Beat Keller an der UZH identifiziert, doch ihre Funktion war bisher unklar. Die LRX-Proteine sitzen ausserhalb der Zelle in der Zellwand, wo die Signalstoffe andocken können. «Damit nimmt der Pollenschlauch vermutlich Änderungen in der Zellwand wahr und reagiert entsprechend, in dem er etwa sein Wachstum neu ausrichtet», sagt Ueli Grossniklaus. Dass dieselbe Zelle, die Signalstoffe produziert, diese auch wahrnimmt, kommt in Pflanzen nur selten vor. Die Wissenschaftler vermuten, dass der schnell wachsende Pollenschlauch so rascher auf Veränderungen in der Umgebung reagieren kann, als wenn er auf Signale von anderen, benachbarten Zellen angewiesen ist.
Molekulare Einblicke eröffnen breites Anwendungspotenzial
Da die im Pollenschlauch aufgeschlüsselten Signalwege auch an vielen anderen grundlegenden Prozessen beteiligt sind, eröffnet das Wissen über ihre Funktionsweise zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für die Pflanzenzucht. «Wenn wir besser verstehen, wie diese Proteine funktionieren, lassen sich nicht nur Befruchtung und Samenbildung, sondern auch Entwicklung und Wachstum von Pflanzen oder die Abwehr von Krankheitserregern beeinflussen», resümiert Ueli Grossniklaus.
Originalveröffentlichung
Martin A. Mecchia, Gorka Santos-Fernandez, Nadine N. Duss, Sofía C. Somoza, Aurélien Boisson-Dernier, Valeria Gagliardini, Andrea Martínez-Bernardini, Tohnyui Ndinyanka Fabrice, Christoph Ringli, Jorge P. Muschietti, Ueli Grossniklaus; "RALF4/19 peptides interact with LRX proteins to control pollen tube growth in Arabidopsis"; Science; 2017