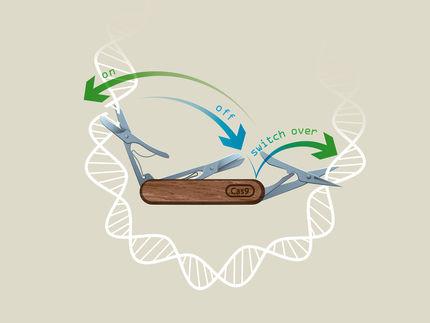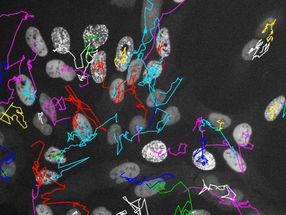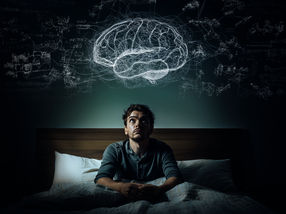Crispr-Cas9: Forscher korrigieren Gendefekt bei Embryonen
Ist das ein wichtiger Schritt zur Prävention von Krankheiten oder ein gefährlicher Weg zum Designer-Baby?
(dpa) Forscher haben bei menschlichen Embryonen einen Gendefekt behoben. Sie korrigierten mit Hilfe der Genschere Crispr-Cas9 eine Mutation, die zu Herzmuskelverdickung (Hypertrophe Kardiomyopathie) führt. Andere Erbgut-Teile wurden dadurch nicht geschädigt, wie die Forscher im Magazin «Nature» betonen. Mit dem Verfahren könne man eines Tages tausende Erbkrankheiten verhindern, schreibt das Team um Shoukhrat Mitalipov von der Oregon Health and Science University in Portland. Die Embryonen wurden nach wenigen Tagen zerstört.

Symbolbild
qimono, pixabay.com, CC0
Bei Mitgliedern des Deutschen Ethikrats stieß die Arbeit auf ein geteiltes Echo. Der Vorsitzende Peter Dabrock spricht von «unseriösen Heilsversprechungen». Dagegen sagt Medizinethikerin Claudia Wiesemann von der Universitätsmedizin Göttingen, die Studie zeige, dass die Technik unter Umständen praktikabel sein könne. Ob dies wünschenswert sei, hänge vom Einzelfall ab. In Deutschland sind solche Versuche verboten.
Menschliche Embryonen wurde schon mehrfach genetisch verändert: So wurden unter anderem Studien aus China bekannt, in denen Forscher versucht hatten, Erbgut mit Hilfe von Crispr-Cas9 zu reparieren - allerdings mit weniger guten Resultaten. Britische Forscher hatten bereits 2008 einen Embryo mit dem Erbgut von drei Eltern geschaffen.
Die Forscher injizierten nun Spermien eines Mannes mit der Erbgut-Mutation in eine Eizelle zusammen mit der Genschere Crispr-Cas9, die den Erbgut-Doppelstrang an der mutierten Stelle aufschneiden sollte: Knapp drei Viertel (72,4 Prozent) der 58 Embryonen in der Studie trugen die krankhafte Mutation später nicht mehr.
«Die Verfahren zur Genom-Editierung müssen optimiert werden, bevor klinische Anwendungen erwogen werden», schreibt das Autoren-Team. Generell entwickelten sich die Embryonen jedoch normal. «Dennoch gibt es eine klare Notwendigkeit sicherzustellen, dass solche Strategien keine anderen schädigenden Wirkungen auf den sich entwickelnden Embryo und sein Genom haben», schreiben Nerges Winblad und Fredrik Lanner vom Stockholmer Karolinska Institut in einem «Nature»-Kommentar.
Originalveröffentlichung
Originalveröffentlichung
Themen
Organisationen
Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang
Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.