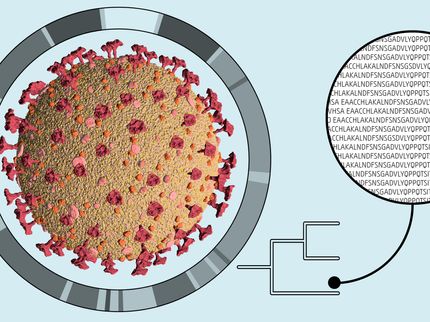Erbgut von 2.500 Menschen entziffert
Was unterscheidet Menschen genetisch voneinander? Was eint sie?
(dpa) Mehr als 200 Gene im menschlichen Erbgut sind für das Funktionieren des Körpers verzichtbar. Das ist nur eine von vielen Erkenntnissen, die ein internationales Forscherteam bei der Untersuchung des Erbguts von mehr als 2.500 Menschen aus vier Kontinenten gewonnen hat. «Wir waren überrascht, über 200 Gene zu entdecken, die in einigen Menschen überhaupt nicht vorhanden sind», sagte einer der Studienleiter, Jan Korbel, vom Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) in Heidelberg.
Die Daten zeigen darüber hinaus, dass es noch bislang unbekannte Mutationswege geben muss, oder welche Regionen des Erbguts möglicherweise eine Rolle bei der Entstehung von Krankheiten spielen. Das Team aus mehreren Hundert Forschern stellt die Ergebnisse des sogenannten 1000-Genome-Projekts in zwei Studien im Fachblatt «Nature» vor.
Das menschliche Genom besteht aus drei Milliarden Bausteinen, die unter anderem einzelne Gene bilden. Aber kein Erbgut gleicht dem anderen. Das 1000-Genome-Projekt war 2008 mit dem Ziel gestartet, rund 2500 menschliche Genome zu sequenzieren und so einen Katalog menschlicher genetischer Variationen zu erstellen. Dieser soll der biomedizinischen Forschung als Datengrundlage dienen und Wissenschaftlern dabei helfen, die Ursachen von Krankheiten und mögliche Ansatzpunkte für Therapien zu finden.
Mit der Veröffentlichung der beiden Studien sehen die Forscher das Projekt nun als beendet an. Die Sequenzdaten sind im Internet abrufbar. «Die Datenbank ist enorm wichtig für die wissenschaftliche Community. Wie überlassen die Daten jetzt der Wissenschaft, etwa den Forschern, die nach den genetischen Grundlagen von Krankheiten suchen», sagte Korbel.
Von europäischer Seite war das EMBL in Heidelberg maßgeblich an dem Projekt beteiligt. Auch Forscher des Max-Planck-Instituts für Molekulare Genetik in Berlin entzifferten mit. Die Forscher sammelten und analysierten Genome aus 26 Populationen - etwa von den Yoruba aus Nigeria, Han-Chinesen, Tamilen aus Sri Lanka, Peruanern und europäischen Subpopulationen in Großbritannien, Italien sowie Finnland. 2012 hatten sie nach der Sequenzierung von mehr als 1000 Genomen bereits erste Ergebnisse vorgestellt. Den neuen zwei Studien liegen nicht nur mehr Genome zugrunde, die Daten sind auch detailreicher.
Knapp 85 Millionen der insgesamt über 88 Millionen entdeckten genetischen Variationen betreffen nur jeweils einen einzigen Baustein. In 3,6 Millionen Fällen waren kleinere Erbgutabschnitte hinzugefügt worden oder verschwunden. Nur 60 000 der gefundenen Abweichungen umfassen größere Abschnitte des Genoms - aber der Einfluss dieser strukturellen Variationen auf die Aktivität von Genen und die Bildung von Proteinen ist sehr viel größer. Die größte genetische Variabilität fanden die Forscher bei Menschen afrikanischen Ursprungs. Da sich der moderne Mensch von Afrika ausgehend um die Welt ausgebreitet hat, sei dies zu erwarten gewesen.
«Unsere Arbeit zeigt, dass strukturelle Variationen vermutlich häufig funktionelle Konsequenzen haben», erläuterte Bioinformatiker Oliver Stegle, der an einem Außeninstitut des EMBL im britischen Hinxton bei Cambridge arbeitet. «Wir können jetzt Tipps geben, wonach Forscher schauen sollen, wenn sie versuchen, die genetische Grundlage einer bestimmten Krankheit zu verstehen.»
«Wir haben einige Variationen gefunden, von denen wir nicht wissen, auf welchem Wege sie entstanden sind. Es muss also bisher unbekannte Mutationsprozesse geben», sagte EMBL-Forscher Korbel. «Das hat uns schon überrascht. Es wird spannend werden herauszufinden, wie diese strukturellen Variationen entstehen.»
Wertvoll für die Wissenschaft sind nach Expertenansicht vor allem auch die Sequenzdaten von Menschen afrikanischer Herkunft. Die neuen Erkenntnisse böten eine weit umfassendere Sicht auf die normalen genetischen Variationen im Menschen als die bisherige, euro-zentrische Sichtweise, schreiben Ewan Birney vom EMBL in Hinxton und Nicole Soranzo vom Wellcome Trust Sanger Institute in Hinxton in einem Kommentar. Dies werde auch kostengünstige genetische Studien in afrikanischen Populationen südlich der Sahara ermöglichen.