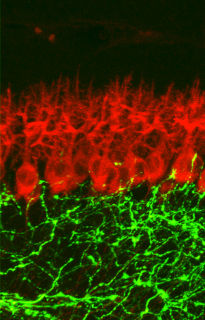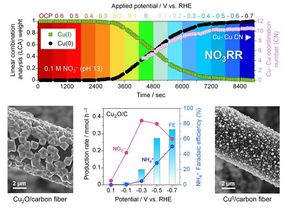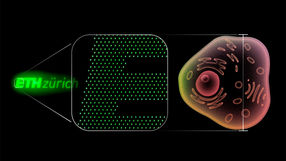Epilepsie-Studie: Erstmals gemeinsame genetische Risikofaktoren entdeckt
Anzeigen
Trotz starker Beweise für die Vererbbarkeit von Epilepsien erbrachte die Suche nach gemeinsamen genetischen Risikofaktoren bislang keine klaren Ergebnisse. Eine auf der Neurowoche vorgestellte Studie unter Tübinger Beteiligung belegt jetzt erstmals, dass es gemeinsame genetische Risikofaktoren bei häufigen Epilepsiesyndromen gibt. In einer internationalen Kooperation identifizierten die Wissenschaftler durch eine sogenannte genomweite Assoziationsstudie (GWAS) drei genetische Risikofaktoren. Für ihre Studie analysierten sie die Daten von 8.696 Epilepsiefällen und 26.157 Kontrollprobanden aus drei Kontinenten.
Der auffälligste der drei identifizierten Genorte liegt in SCN1A, dem wichtigsten bisher bekannten Epilepsie-Gen. Schwerwiegende Mutationen, die eine von zwei vorhandenen Kopien dieses Gens zerstören, liegen dem Dravet-Syndrom zugrunde. Dabei handelt es sich um eine seltene, schwere Epilepsieform des Kindesalters, in deren Verlauf auch die geistige Entwicklung stark beeinträchtigt wird. Die mit häufigen Epilepsien assoziierte Variante in SCN1A kann als „Risikofaktor mit geringer Effektstärke“ betrachtet werden. Das SCN1A Gen enthält die verschlüsselte Sequenz für einen Natriumkanal. Dieser spielt eine wichtige Rolle für die Hemmung im Gehirn, die durch Epilepsie-Mutationen vermindert wird. Dadurch werden epileptische Anfälle begünstigt.
Zu der möglichen Rolle der anderen beiden Risikofaktoren in den Genen PCDH7 und VRK2 ist bislang noch nicht viel bekannt. „Obwohl die Wirkung jedes einzelnen Risikofaktors gering ist, nehmen wir an, dass ein wesentliches kumulatives Risiko besteht“, sagt Professor Dr. Holger Lerche, Vorstand am Hertie-Institut für klinische Hirnforschung (HIH) und Ärztlicher Direktor der Abteilung Neurologie mit Schwerpunkt Epileptologie des Universitätsklinikums Tübingen. Das heißt, je höher die Anzahl an Risikofaktoren desto höher das Erkrankungsrisiko. Ein einzelner Risikofaktor reicht jedoch nicht aus, um eine Epilepsie definitiv vorherzusagen.
„Die Entdeckung gibt uns erstmals Hinweise auf den komplexen zugrundeliegenden Krankheitsmechanismus häufiger Epilepsieformen“, erläutert Lerche. Auch auf die Behandlung haben genetische Faktoren bereits Einfluss. „Bei Vorliegen schwerwiegender SCN1A Mutationen, vermeidet man bereits heute eine wichtige Gruppe von antiepileptisch wirksamen Substanzen, die Natriumkanäle blockieren. Häufige SCN1A Varianten könnten auch für die häufigen Epilepsien ein Teilfaktor werden, der Auskunft darüber geben könnte, welche Medikamente ansprechen und welche nicht.“