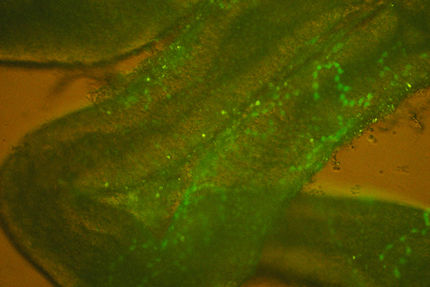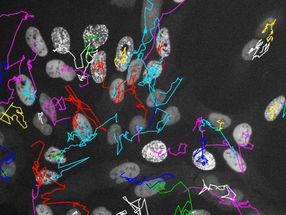Ein Entwurf für ein zeitgemäßes Fortpflanzungsmedizingesetz
Augsburger und Münchner Juristen stellen in Form des AME-FMedG eine grundsätzliche Novellierung des Fortpflanzungsmedizinrechts für die Bundesrepublik Deutschland vor
Sechs Medizin- und Gesundheitsrechtler der Universität Augsburg und der Ludwig-Maximilians-Universität München haben einen Gesetzentwurf für ein zeitgemäßes Fortpflanzungsmedizingesetz vorgelegt: den AME-FMedG (Fortpflanzungsmedizingesetz – Augsburg-Münchner-Entwurf). Dieser Entwurf stellt eine grundsätzliche Novellierung des Fortpflanzungsmedizinrechts für die Bundesrepublik Deutschland vor. Vorgeschlagen werden Neuregelungen für die künstliche Befruchtung, die Präimplantationsdiagnostik (PID), die Samen- und Eizellspende, den Embryonentransfer und die Leihmutterschaft sowie für den Umgang mit "überzähligen" Embryonen. Missbräuchliche Fortpflanzungstechniken wie das Klonen sollen grundsätzlich untersagt werden.
Das Warten auf ein Fortpflanzungsmedizingesetz ist in Deutschland weit verbreitet. Das Embryonenschutzgesetz aus dem Jahre 1990 ist in seinen biomedizinischen wie rechtlichen Grundlagen veraltet und heute nicht mehr zeitgemäß. Allerdings scheitern Novellierungsversuche seit Jahren am Streit um den verfassungsrechtlichen Status des Embryos.
Sechs Juraprofessoren der Universität Augsburg und der Ludwig-Maximilians-Universität München haben sich mit diesem unbefriedigenden Zustand nicht abfinden wollen. Die Medizin- und Gesundheitsrechtler Gassner, Lindner und Rosenau (Augsburg) sowie Kersten, Krüger und Schroth (München) haben daher in den vergangenen zwei Jahren unter Mitwirkung der Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Dorneck und von Wietersheim einen Gesetzentwurf für ein zeitgemäßes Fortpflanzungsmedizingesetz erarbeitet: den AME-FMedG.
Weitreichender Konsens
Dabei hat sich gezeigt, dass jenseits der Frage nach dem Status des Embryos und trotz unterschiedlicher biopolitischer Positionen ein weitreichender Konsens über die Regelungen eines Fortpflanzungsmedizingesetzes zu erreichen war, der insbesondere die verfassungsrechtlichen Vorgaben konsequent achtet und die aktuellen Fragen der modernen Biomedizin und Fortpflanzungstechnik ebenso praktikabel wie vertretbar löst. Aus einer in dieser Form einzigartigen Zusammenarbeit zweier deutscher juristischer Fakultäten ist ein Gesetzentwurf hervorgegangen, mit dem Deutschland Anschluss an den modernen Stand der Gesetzestechnik auf dem Feld der Biopolitik fände, wie ihn etwa Österreich und die Schweiz bereits erreicht haben. Die Autoren des AME-FMedG hoffen daher, dass ihre Vorschläge beim Deutschen Bundestag auf Resonanz stoßen.
Umfassend und in sich konsistent
Der AME-FMedG regelt in 29 Paragraphen umfassend und in sich konsistent den Bereich der Fortpflanzungsmedizin. Er geht dabei von einem verfassungsrechtlich verbürgten subjektiven Anspruch jedermanns aus, ein Verfahren der medizinisch unterstützten Fortpflanzung in Anspruch zu nehmen. Die Einschränkung eines solchen Grundrechts auf reproduktive Selbstbestimmung ist verfassungsrechtlich nur dann legitimierbar, wenn diese selbst nach rationalen Kriterien verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden können. Daraus folgt im Einzelnen, dass etwa die Präimplantationsdiagnostik (PID) über die derzeitige Rechtslage hinaus dann zulässig ist, wenn ein Schwangerschaftsabbruch von Rechts wegen zu akzeptieren wäre. Neben der Samenzellenspende wird auch die Eizellspende für zulässig gehalten, denn das bisherige Verbot der Eizellspende ist mit rationalen Überlegungen nicht begründbar. Gleiches gilt für die Leihmutterschaft, weil es keinen Anhaltspunkt gibt, dass das Kindeswohl bei gespaltener Mutterschaft Schaden nimmt. Ausdrücklich wird der Embryonentransfer zugelassen, weil so der Embryo am weitestgehenden geschützt werden kann.
Geregelt und grundsätzlich verboten werden missbräuchliche Fortpflanzungstechniken. Aber auch hier sieht der Gesetzentwurf jeweils Differenzierungen vor. Zu diesen Techniken gehört die Geschlechtswahl, die nur zulässig ist, wenn eine medizinische Indikation vorliegt. Ferner zählt dazu die Keimbahnintervention, die erst dann zulässig sein wird, wenn das Verfahren in der Zukunft sicher ist und es dazu dient, schwerwiegende Beeinträchtigungen des körperlichen oder psychischen Gesundheitszustandes zu verhindern. Beim Klonen wird ein Alternativvorschlag vorgelegt: Entweder wird das Klonen umfassend untersagt oder aber - alternativ dazu - nur das reproduktive Klonen, so dass das sogenannte therapeutische Klonen also möglich bliebe. Untersagt wird auch die Chimären- und Hybridbildung, soweit sie nicht etwa im Rahmen der Xenotransplantation erfolgt. Ausdrücklich geregelt wird hier auch die Möglichkeit der Forschung an überzähligen Embryonen einschließlich der Gewinnung von Stammzellen. Im Entwurf folgen schließlich detaillierte Regelungen zum Arztvorbehalt, zur Aufklärung, Beratung, Einwilligung, Dokumentation und zum Auskunftsrecht der Beteiligten, und es wird – den bewährten Einrichtungen aus anderen Gesundheitsbereichen nachgebildet – eine Fortpflanzungsmedizin-Kommission eingerichtet.