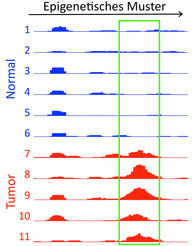Seltener Gendefekt der Hutterer aufgeklärt
Frankfurter Hefeforscher und kanadische Humangenetiker finden molekulare Ursache des Bowen-Conradi Syndroms
Anzeigen
Das Bowen-Conradi Syndrom ist eine sehr seltene Erbkrankheit, die fast ausschließlich bei der Lebensgemeinschaft der Hutterer auftritt. Deren heutige Population von etwa 40.000 Personen lässt sich auf weniger als 100 Gründer zurückführen, die 1870 von Südtirol nach Süd Dakota auswanderten und seither fast nur untereinander heirateten. Das begünstigte die Verbreitung des sehr seltenen Gendefekts, der das Bowen-Conradi-Syndrom (BCS) hervorruft. Von 355 Neugeborenen ist bei den Hutterern ein Kind betroffen: Es weist ausgeprägte vor- und nachgeburtliche Entwicklungsstörungen auf, die eine hohe Sterblichkeit im ersten Lebensjahr zur Folge haben. Jeder 10. Hutterer ist Träger des verantwortlichen rezessiven genetischen Defekts. Frankfurter Hefeforschern ist es in Zusammenarbeit mit kanadischen Humangenetikern nun gelungen, das verantwortliche Gen zu identifizieren und den Defekt auf eine Punktmutation zurückzuführen. Wie die Forscher im American Journal of Human Genetics berichten, codiert das Gen für ein Protein, das für die Herstellung von Ribosomen notwendig ist.
Ribosomen haben die Aufgabe, die genetische Information in Proteine zu übersetzen. Viele an der Herstellung von Ribosomen beteiligte Proteine sind deshalb lebenswichtig; so auch das von den Forschern identifizierte Nep1 Protein, dessen Veränderung für die Entstehung von BCS verantwortlich ist. Interessant ist, dass dieses Protein offensichtlich sowohl im Menschen als auch in der Hefe die gleiche Funktion ausübt. Das stellte die Frankfurter Arbeitsgruppe von Prof. Karl-Dieter Entian und Dr. Peter Kötter fest, als sie das menschliche Protein in die Bäckerhefe einsetzten. Damit können wesentliche Erkenntnisse über die molekularen Ursachen von BSC in der Bäckerhefe auf den Menschen übertragen werden.
Dies ist der Grund, warum die kanadischen Humangenetiker Prof. Barbara Triggs-Raine und Prof. Klaus Wrogemann von der Universität Manitoba die Kooperation mit den Frankfurter Hefespezialisten suchten. Dank einer intensiven Zusammenarbeit konnten die beiden Arbeitsgruppen zunächst nachweisen, dass der genetische Defekt eindeutig mit BCS korreliert und das Nep1 Protein bei gesunden Menschen an die RNA, einen wichtigen Bestandteil der Ribosomen, bindet. Sie konnten zudem zeigen, dass bei BCS-Kranken die Menge des Proteins am Ort des Zusammenbaus der Ribosomen deutlich erniedrigt ist und die genetisch veränderten Krankheitsproteine miteinander verkleben.
Welche Auswirkungen die genetische Veränderung auf das Protein hat, konnten die Frankfurter Hefegenetiker um Entian gemeinsam mit dem Frankfurter Strukturbiologen Prof. Jens Wöhnert im Detail schon im vergangenen Jahr zeigen. Die Strukturaufklärung eines verwandten dimeren Nep1 Proteins zeigt, dass zwei identische Untereinheiten dieses Proteins eine Furche ausbilden, in die sich RNA einlagern kann. Zeitgleich wurde auch die Struktur des monomeren, aus einer Untereinheit bestehenden Proteins unter Mitwirkung von Dr. Markus Bohnsack, der inzwischen auch in Frankfurt arbeitet, aufgeklärt. Beide Strukturen weisen darauf hin, dass veränderte Nep1 Proteine RNA nicht effektiv binden können und daher ihre Funktion nur fehlerhaft ausüben können.
Die Untersuchungen zeigen, wie wichtig Grundlagenforschung für die Aufklärung seltener Erbkrankheiten ist. Die gewonnenen Erkenntnisse bringen wesentliche Fortschritte für die Diagnose. Durch molekulargenetische Analyse lässt sich die tatsächliche Verbreitung von BCS in der Bevölkerung nun untersuchen und von einer Reihe anderer Krankheitsbilder mit ähnlichen Symptomen unterscheiden. Eventuell werden so auch Nep1 Mutationen mit weniger stark ausgeprägten Krankheitsbild nachgewiesen. "Die gewonnen Erkenntnisse ermöglichen es zukünftig - falls gewünscht - das Bowen-Conradi-Syndrom durch pränatale Diagnose zuverlässig vorhersagen, und vielleicht gelingt es mit dem Hefemodellsystem in den kommenden Jahren auch einen Wirkstoff zu finden, der die Funktion des betroffenen Proteins zumindest teilweise wieder herstellt und eventuell die Entstehung von BCS verhindert", sagt Entian.