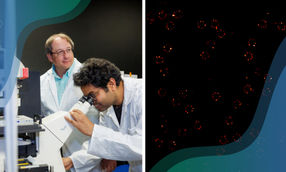BU-Forscher entwerfen künstliche Gene, um zelluläre Reaktionen auf Medikamente zu erkennen
Das Verständnis der Zellkommunikation gilt als Schlüssel zur Entwicklung neuer und verbesserter Medikamente für ein breites Spektrum von Gesundheitszuständen.
Forscher der Boston University School of Medicine (BUSM) haben eine neue Methode entwickelt und implementiert, um besser zu verstehen, wie menschliche Zellen miteinander kommunizieren, wie diese Kommunikation bei menschlichen Krankheiten gestört ist und wie dies pharmakologisch korrigiert werden kann.

qimono/ Pixabay
Ihre Methode besteht aus einer Reihe von "Biosensoren", das sind künstliche Gene, die in Zellen eingeführt werden können, um in Echtzeit zu melden, wenn eine wichtige Gruppe von Signalmolekülen eingeschaltet wird. Diese Signalmoleküle, "G-Proteine", sind molekulare Ein- und Ausschalter im Inneren von Zellen. Sie werden von einer großen Familie von Rezeptorproteinen eingeschaltet, die ein sehr breites Spektrum von Stimuli wahrnehmen, darunter Licht, Gerüche, Neurotransmitter und Hormone.
Dieser Signalmechanismus ist über mehrere Jahrzehnte hinweg untersucht worden. Das Neue an diesen "Biosensoren" ist jedoch, dass sie entwickelt wurden, um G-Proteine mit einer Genauigkeit zu untersuchen, die vorher nicht möglich war. "Diese Biosensoren sind gute 'Spione' in dem Sinne, dass sie uns in Echtzeit mit einer Auflösung von einigen zehn Millisekunden sagen können, was die G-Proteine tun, ohne den beobachteten Signalprozess zu stören", erklärte der korrespondierende Autor Mikel Garcia-Marcos, PhD, außerordentlicher Professor für Biochemie am BUSM. "Darüber hinaus haben unsere Biosensoren den Vorteil einer einfachen Implementierung, die es uns erlaubt, G-Proteine direkt in experimentellen Systemen zu untersuchen, die vorher nicht zur Verfügung standen".
Die Forscher nutzten die molekulare Technik, um ihre Biosensoren zu schaffen, indem sie Teile von bestehenden Genen entlehnten, darunter Gene, die für fluoreszierende Proteine von Quallen kodieren, formverändernde Proteine, die Muskeln kontrahieren lassen, lichtemittierende Proteine von Tiefseegarnelen und Proteine, von denen bekannt ist, dass sie aktive G-Proteine spezifisch erkennen. Dann brachten sie die manipulierten Gene, die die Biosensoren bilden, in verschiedene Zelltypen ein und untersuchten, wie sie auf Stimulation durch natürliche Reize wie Neurotransmitter oder klinisch verwendete Medikamente reagieren.
Nach Angaben der Forscher wirken mehr als ein Drittel der von der FDA zugelassenen Medikamente, indem sie die Signalübertragung durch G-Proteine aktivieren oder hemmen. Dazu gehören gängige Allergiemedikamente, Nasenschleimhautabschwellungsmittel, hoch verschriebene Medikamente gegen Blutdruck, Erstlinienbehandlung von Parkinson, Analgetika, Antipsychotika sowie Cannabis und Opioide.
Hauptautor Marcin Maziarz, PhD, Postdoc im Labor von Garcia-Marcos, glaubt, dass diese Biosensoren bei der Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln und bei der Charakterisierung der Wirkungsweise vieler bestehender Medikamente eine entscheidende Rolle spielen können. "Was wir heute tun, ist wichtig, weil es Forschern ermöglichen wird, leichter und genauer Medikamente zu identifizieren, die in klinischen Studien mit größerer Wahrscheinlichkeit erfolgreich sein werden, da viele Medikamente, die in experimentellen Systemen zunächst vielversprechend sind, letztendlich keine klinischen Ergebnisse liefern", sagte er.
Hinweis: Dieser Artikel wurde mit einem Computersystem ohne menschlichen Eingriff übersetzt. LUMITOS bietet diese automatischen Übersetzungen an, um eine größere Bandbreite an aktuellen Nachrichten zu präsentieren. Da dieser Artikel mit automatischer Übersetzung übersetzt wurde, ist es möglich, dass er Fehler im Vokabular, in der Syntax oder in der Grammatik enthält. Den ursprünglichen Artikel in Englisch finden Sie hier.
Meistgelesene News
Themen
Organisationen
Weitere News aus dem Ressort Wissenschaft
Diese Produkte könnten Sie interessieren

Octet RH16 and RH96 von Sartorius
Effiziente Proteinanalyse im Hochdurchsatz zur Prozessoptimierung und Herstellungskontrolle
Markierungsfreie Protein-Quantifizierung und Charakterisierung von Protein-Protein Wechselwirkungen

Octet SF3 von Sartorius
Molekulare Bindungskinetik und Affinität mit einer einzigen dynamischen SPR-Injektion
Die Kurvenkrümmung ist der Schlüssel akkurater biomolekularer Wechselwirkungsanalyse

Octet R2 / Octet R4 / Octet R8 von Sartorius
Vollgas auf 2, 4 oder 8 Kanälen: Molekulare Wechselwirkungen markierungsfrei in Echtzeit analysieren
Innovative markierungsfreie Echtzeit-Quantifizierung, Bindungskinetik und schnelle Screening-Assays

Holen Sie sich die Life-Science-Branche in Ihren Posteingang
Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass Ihnen die LUMITOS AG den oder die oben ausgewählten Newsletter per E-Mail zusendet. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die LUMITOS AG erfolgt auf Basis unserer Datenschutzerklärung. LUMITOS darf Sie zum Zwecke der Werbung oder der Markt- und Meinungsforschung per E-Mail kontaktieren. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der LUMITOS AG, Ernst-Augustin-Str. 2, 12489 Berlin oder per E-Mail unter widerruf@lumitos.com mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Zudem ist in jeder E-Mail ein Link zur Abbestellung des entsprechenden Newsletters enthalten.
Meistgelesene News
Weitere News von unseren anderen Portalen
Zuletzt betrachtete Inhalte
Holocaust-Überlebende vererben Trauma an ihre Kinder - Traumatische Erfahrungen noch vor der Schwangerschaft führen zu epigenetischen Veränderungen bei den betroffenen Eltern und deren Kindern
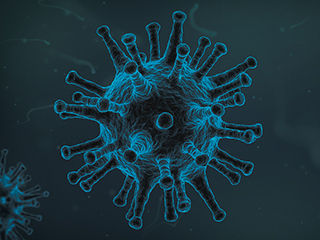
Wie Herpesviren das Immunsystem austricksen - Wie ein Tumorvirus gezielt ein Protein seines Wirts für die Infektion nutzt
Appetitzügler für Fresszellen - Grippeerkrankung bremst Teile des Immunsystems und begünstigt bakterielle Infektionen
Bayer will Kosten sparen und Arbeitsplätze abbauen
Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM) e.V. - Bonn, Deutschland

Forschungsprojekte der Chemie- und Pharmaindustrie 2020: Zuversicht überwiegt - Corona-Pandemie enthüllt Schwächen des Innovationsstandorts