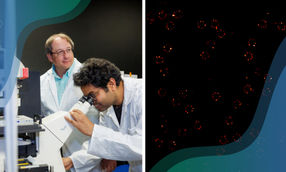Leuchtende Nanopartikel helfen bei Früherkennung von Krebs
Eine Forschungsgruppe aus Innsbruck untersuchte in einem vom Wissenschaftsfonds FWF finanzierten Projekt, wie Krebszellen im Dickdarm zum Leuchten gebracht werden können, um eine frühe Erkennung zu erleichtern.
Dickdarmkrebs ist eine der tödlichsten Krebsarten. Sie ist die in unseren Breiten am zweithäufigsten auftretende Variante von Krebs. Im Frühstadium kann Dickdarmkrebs gut therapiert werden, der sich entwickelnde Tumor lässt sich einfach entfernen. Meist wird der Krebs aber erst sehr spät entdeckt, wo die Behandlung bereits sehr schwierig ist. Ab dem 50. Lebensjahr wird deshalb ein Screening-Programm international empfohlen, das alle 5 Jahre durchgeführt werden soll. Bei der dabei durchgeführten Darmspiegelung wird der Dickdarm Quadratzentimeter für Quadratzentimeter auf Tumore untersucht und gefährliches Gewebe sofort entfernt. Doch selbst dabei wird ein Teil der kleinen Tumore übersehen, oft mit dramatischen Folgen, besonders, wenn diese Untersuchung nicht regelmäßig durchgeführt wird.
Eine Forschungsgruppe um den Biologen Paul Debbage von der Medizinischen Universität Innsbruck hat nun im Rahmen des EU-Projekts „NanoEFEct“ und mit Unterstützung des Wissenschaftsfonds FWF nach Wegen gesucht, die Krebszellen mit leuchtenden Substanzen zu markieren, um diese beim Screening besser sichtbar zu machen.
Krebs im Frühstadium nicht erkannt
„Das Darmkrebs-Screening ist eigentlich eine sehr gute Vorsorge“, sagt Debbage, „doch es gibt hier eine Lücke, weil einige Prozent der Karzinome nicht erkannt werden.“ Um diese Lücke zu schließen, entwickelten unter der Leitung von Debbage Forscherteams in Portugal, Norwegen und Innsbruck fluoreszierende Nanopartikel, die an die Zell-Membranen der Krebszellen binden sollten. Die Nanopartikel sind dabei um einiges größer als die Eiweißmoleküle der Zellen, aber um ein Vielfaches kleiner als die Zellen selbst. „Die Nanopartikel des Teams in Innsbruck hatten Durchmesser von 30 Nanometer.“ Das ist etwa ein Fünfhundertstel bis ein Fünftausendstel der Dicke eines menschlichen Haares.
Man befinde sich hier in einem Größenbereich, wo bereits quantenphysikalische Effekte auftreten, so der Forscher: „Es gibt hier eine Vielzahl von Wirkungen, die wir in der normalen Welt nicht erfahren.“ Wegen der Quanteneffekte leuchten die Nanopartikel sehr hell und dies sei wichtig, erklärt Debbage: „Bei einer Darmspiegelung sieht der Mediziner, der die Untersuchung durchführt, eine rosafarbene Welt. Hier müssen die Krebszellen stark aufleuchten, um gerade frühe Stadien des Krebses gut erkennenbar zu machen.“
Nanopartikel aus Bausteinen des menschlichen Körpers
Gudrun Thurner, langjähriges Mitglied der Innsbrucker Gruppe, erklärt den Zugang, der in Innsbruck gewählt wurde: „Unsere Nanopartikel basieren auf einem Bestandteil des Blut-Serums. Sie tragen auf der einen Seite einen Farbstoff und auf der anderen Seite einen Antikörper des Immunsystems.“ Antikörper können bestimmte Eiweißstrukturen erkennen, um im Körper Krankheitserreger auszuschalten. Die hier verwendeten Antikörper sollen ein bestimmtes Eiweiß in der Zellmembran der Krebszellen erkennen und sich daran binden. „Unsere Nanopartikel bestehen also hauptsächlich aus menschlichen Bestandteilen, wobei ein winziger Teil – der Antikörper – tierischen Ursprungs ist. Dies vermindert das Risiko, dass das Nanopartikel oder seine Bestandteile im Körper toxisch wirken könnte.“
Diese Frage nach der Toxizität ist bei Nanopartikeln nicht trivial, weil Nanopartikel, die ins Blut gelangen, in einigen Organen Schaden anrichten könnten. Die Zusammensetzung aus vorwiegend menschlichen Materialien bietet eine gewisse Absicherung bei den Zulassungsverfahren, die sehr aufwendig sind. Thurner betont, dass die Innsbrucker Teilchen mit 30 Nanometern die perfekte Größe hätten, um in die Krebszellen aufgenommen zu werden. „Außerdem haben wir viel Know-how investiert, um sicherzugehen, dass der Antikörper am Partikel für seine Bindungsfunktion perfekt ausgerichtet ist. Zudem ist das Nanopartikel so konstruiert, dass es im Darm nicht zerfallen kann.“ Gudrun Thurner hat sich also auf einen „menschlichen“ Zugang spezialisiert, während das Team in Portugal mit Nanopartikeln aus Gold arbeitet und das Team in Norwegen mit solchen aus Kunststoff. Den drei Teams ist es gelungen, an Mäusen zu zeigen, dass die Methode funktioniert.