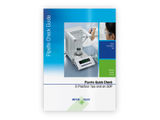Um alle Funktionen dieser Seite zu nutzen, aktivieren Sie bitte die Cookies in Ihrem Browser.
my.bionity.com
Mit einem my.bionity.com-Account haben Sie immer alles im Überblick - und können sich Ihre eigene Website und Ihren individuellen Newsletter konfigurieren.
- Meine Merkliste
- Meine gespeicherte Suche
- Meine gespeicherten Themen
- Meine Newsletter
Ailurophobie
Unter Ailurophobie (griech. αἴλουρος ailuros „Katze“, phobia „Angst“; andere Transskriptionen: Aelurophobie, Elurophobie) versteht man die Angst vor Katzen. Seltener verwendete Begriffe für diese Verhaltensweise sind Felinophobie, Galeophobie (eigentlich Wieselfurcht, da die Griechen lange nur Wiesel kannten, wurden Katzen anfangs als Wiesel bezeichnet) und Gatophobie (Neuzeitliches, germanischstämmiges Lehnwort). Weiteres empfehlenswertes FachwissenIm Unterschied zu anderen weit verbreiteten Tierphobien wie Arachnophobie (Angst vor Spinnen) oder Kynophobie (Angst vor Hunden) ist Ailurophobie nicht allein aus Ekel oder Furcht vor Bissen erklärbar. Laut Desmond Morris könnte diese Angststörung bei manchen Menschen auf einem unterdrückten Sexualtrieb beruhen. Auch Katzenhass kann eine Ausdrucksform von Ailurophobie sein. Die American Psychiatric Association gibt an, dass weltweit mehr als 15 Millionen Menschen an Ailurophobie leiden. Die wohl bekannteste Person, die (angeblich) unter Ailurophobie litt, war Napoleon. |
||||||||
| Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Ailurophobie aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. | ||||||||
- Moritz_Roth
- Stuttgart_Neural_Network_Simulator
- Magnetische 3D-Zellkulturtechnik – eine einfache und effektive Technologie mit breitem Anwendungsgebiet - Ein effektives Hilfsmittel für die Bildung von Sphäroiden in der Wirkstoff-, Stammzellen- und Grundlagenforschung
- The secret of stable dust - Findings open up new ways of treating sick children
- Immune cells with a dual role: switching between protection and attack - Rsearchers show that a certain type of immune cell acts more flexibly than previously thought - with potential for new therapeutic approaches